Qualifikationsphase, Unterrichtsbeispiel: "Risikofaktor Migrationshintergrund? - Migration, soziale Ungleichheit und Lebenschancen in der Einwanderungsgesellschaft Deutschland"
Unterrichtsbeispiel
Qualifikationsphase, konkretisiertes Unterrichtsvorhaben: Risikofaktor Migrationshintergrund? - Migration, soziale Ungleichheit und Lebenschancen in der Einwanderungsgesellschaft Deutschland (orientiert am Kernlehrplan Soziologie für das Abendgymnasium und Kolleg in Nordrhein-Westfalen).
Übergeordnete Kompetenzen:
Sachkompetenz:
Die Studierenden
- analysieren komplexere gesellschaftliche Bedingungen (SK 1),
- erläutern komplexere politische, ökonomische und soziale Strukturen, Prozesse, Probleme und Konflikte unter den Bedingungen von Globalisierung, ökonomischen und ökologischen Krisen sowie von Krieg und Frieden (SK 2),
- erklären komplexere sozialwissenschaftliche Modelle und Theorien im Hinblick auf Grundannahmen, Elemente, Zusammenhänge und Erklärungsleistung (SK 3),
- stellen Anspruch und Wirklichkeit von Partizipation in nationalen und supranationalen Prozessen dar (SK 4),
- analysieren komplexere Erscheinungsformen, Ursachen und Auswirkungen verschiedener Formen von Ungleichheit (SK 6).
Methodenkompetenz:
Die Studierenden
- erheben fragen- und hypothesengeleitet Daten und Zusammenhänge durch empirische Methoden der Sozialwissenschaften und wenden statistische Verfahren an (MK 2),
- analysieren unterschiedliche sozialwissenschaftliche Textsorten wie kontinuierliche und diskontinuierliche Texte (u.a. positionale und fachwissenschaftliche Texte, Fallbeispiele, Statistiken, Karikaturen sowie andere Medienprodukte) aus soziologischer Perspektive (MK 4),
- stellen themengeleitet komplexere Fallbeispiele und Probleme in ihrer empirischen Dimension und unter Verwendung passender soziologischer Fachbegriffe, Modelle und Theorien dar (MK 6),
- präsentieren Lösungsansätze, Alternativen oder Verbesserungsvorschläge zu einer konkreten gesellschaftlichen Problemstellung (MK 7),
- ermitteln – auch vergleichend – Prämissen, Grundprinzipien, Konstruktion sowie Abstraktionsgrad und Reichweite soziologischer Modelle und Theorien und überprüfen diese auf ihren Erkenntniswert (MK 12),
- ermitteln typische Versatzstücke ideologischen Denkens (u.a. Vorurteile und Stereotypen, Ethnozentrismen, Chauvinismen, Rassismus, Biologismus) (MK 18).
Urteilskompetenz:
Die Studierenden
- entwickeln auf der Basis der Analyse der jeweiligen Interessen- und Perspektivleitung der Argumentation Urteilskriterien und formulieren abwägend kriteriale selbstständige Urteile (UK 1),
- erörtern exemplarisch die gegenwärtige und zukünftige Gestaltung von gesellschaftlichen Strukturen und Prozessen unter Kategorien der Funktionalität und Legitimität sowie ihres Verhältnisses zur Tradition (UK 4),
- ermitteln die jeweiligen Prämissen von Position und Gegenposition (UK 6).
Handlungskompetenz:
Die Studierenden
- praktizieren selbstständig Formen demokratischen Sprechens und demokratischer Aushandlungsprozesse und übernehmen dabei Verantwortung für ihre Sprechhandlungen (HK 1),
- entwerfen für diskursive, simulative und reale soziale Handlungssituationen zunehmend komplexe Handlungspläne und übernehmen fach-, situationsbezogen und adressatengerecht die zugehörigen Rollen (HK 2),
- entwickeln aus der Analyse zunehmend komplexerer gesellschaftlicher Konflikte angemessene Lösungsstrategien und wenden diese an (HK 3),
- nehmen in diskursiven, simulativen und realen Aushandlungsszenarien des eigenen Erfahrungsraums einen Standpunkt ein und treffen Entscheidungen in Abwägung mit den Interessen anderer (HK 4),
Inhaltsfeld:
IF 6: Soziale Ungleichheit und soziale Sicherung, IF 7: Soziologische Dimensionen der Kultur, IF 4: Normierungen und Wertorientierungen
Inhaltliche Schwerpunkte:
- Erscheinungsformen und Auswirkungen sozialer Ungleichheit
- Modelle und Theorien gesellschaftlicher Ungleichheit
- Sozialstaatliches Handeln
- Macht und soziale Kontrolle
- Soziale und kulturelle Teilhabe
Zeitbedarf: Insgesamt ca. 14 Std.
Fachdidaktische Idee:
"Risikofaktor Migrationshintergrund?" - Diese Fragestellung steht im Zentrum des vorliegenden Unterrichtsvorhabens, das sich mit der Diskussion über die ungleiche Chancenverteilung in der Gesellschaft befasst. Weiter angefacht wird und wurde die Diskussion insbesondere durch die große Zahl der Asylsuchenden im Jahr 2015, denn die "Flüchtlingskrise" stellte die Gesellschaft vor eine enorme Herausforderung. Unterkünfte mussten organisiert, Sprachklassen und -kurse eingerichtet und Sozialleistungen geregelt werden. In der öffentlichen Debatte ging es häufig auch darum, unter welchen Bedingungen es Menschen mit Migrationshintergrund möglich ist, sich zu integrieren und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Oft wird zudem darüber diskutiert, welche Bildungs- und Qualifizierungsangebote zur Verfügung stehen, inwiefern eine Integration in den Arbeitsmarkt möglich ist und wie hoch das Armutsrisiko bei Menschen mit Migrationshintergrund bzw. Fluchterfahrung liegt. Ziel des Unterrichtsvorhabens ist es daher, eine Antwort auf die Frage zu finden, ob Migrantinnen und Migranten die gleiche Chance auf Teilhabe in der Gesellschaft wie Menschen ohne Migrationshintergrund besitzen oder ob die gesellschaftlichen Chancen ungleich verteilt sind. Dazu können - je nach Vorwissen und Lernausgangslage innerhalb der Lerngruppe - auch nur einzelne Sequenzen des Unterrichtsvorhabens thematisiert bzw. unabhängig voneinander als Bausteine verwendet werden.
Baustein 1: Zum Einstieg in das Unterrichtsvorhaben bietet es sich an, ein Rollenspiel (s. Methodenkarte im Anhang) durchzuführen, durch das die Empathie der Studierenden mit Menschen, die nicht der "Mehrheitsgesellschaft" angehören, gefördert und die Lerngruppe für die ungleiche Chancenverteilung in der Gesellschaft sensibilisiert werden kann. Dazu sollen sich die Studierenden in unterschiedliche Rollen hineinversetzen und ausgehend von einer Startlinie im Raum zu verschiedenen Aussagen Stellung beziehen, indem sie - je nachdem, ob sie der jeweiligen Aussage zustimmen oder nicht - ggf. einen Schritt nach vorne machen. In einer Auswertungs- und Nachbesprechungs-phase sollen sie anschließend über ihre Wahrnehmung der sozialen Ungleichheit in Deutschland sprechen und diese reflektieren. Außerdem sollten im Plenum Leitfragen für das Unterrichtsvorhaben entwickelt und auf einem Poster festgehalten werden. Mögliche Leitfragen könnten dabei beispielsweise sein: Befinden sich Angehörige bestimmter Bevölkerungsgruppen häufiger in finanzieller Not als andere? Sind Menschen mit Migrationshintergrund stärker von Armut bedroht? Besitzen migrierte Menschen die gleichen Bildungs- und Teilhabechancen wie nicht-migrierte? Was könnten Gründe für die ungleiche Chancenverteilung in der Gesellschaft sein? Was wird und was könnte gegen soziale Ungleichheit getan werden?
Baustein 2: Der zweite Baustein beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen sozialer Ungleichheit und ethnischer Herkunft. Dazu sollen die Studierenden zunächst die Lebensziele, Wünsche und Zukunftserwartungen von Menschen mit Migrationshintergrund auf Grundlage von Auszügen aus dem Zwischenbericht zu den Migranten-Lebenswelten aus dem Jahr 2016 untersuchen, indem sie sich die Sinus-Milieus migrierter Menschen erschließen. Daran anschließend sollen sie diese in Beziehung zum Ist-Zustand setzen und ausgewählte Statistiken zu den Bildungs-, Berufs- und Einkommenschancen von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund analysieren und vergleichen. Die Erkenntnis, dass sich die soziale Lage von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund voneinander unterscheidet, führt schließlich zu der Frage, welche soziologischen Erklärungen es für diese Ungleichheit gibt. Exemplarisch kann dazu die Kapitaltheorie Pierre Bourdieus herangezogen und arbeitsteilig im Hinblick auf die unterschiedlichen Kapitalsorten untersucht werden. Welche Erklärungskraft Bourdieus Theorie der sozialen Ungleichheit für Menschen mit Migrationshintergrund besitzt, sollen die Studierenden abschließend durch das Verfassen einer Erörterung bewerten.
Baustein 3: Gleiche Qualifikation, ungleiche Chancen? Um die Frage der Diskriminierung von Menschen mit Migrationshintergrund am Arbeitsmarkt geht es im dritten Baustein. Die zuerst vorgenommenen subjektiven Einschätzungen der Studierenden werden dazu mit Statistiken aus dem Forschungsbericht des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für Integration und Migration aus dem Jahr 2014 verglichen. So gelangen die Studierenden schließlich zu der Erkenntnis, dass bei der Vergabe von Stellen bzw. Ausbildungsplätzen neben klar leistungsbezogenen und formalen Anforderungen auch die soziokulturelle Herkunft ein relevantes und empirisch belegtes Kriterium ist, also z.B. der kulturelle Hintergrund, die Muttersprache oder die Religionszugehörigkeit. Folglich werden Bewerberinnen und Bewerber mit ausländisch klingenden Namen weniger häufig zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen als Jugendliche ohne Migrationshintergrund. Ob durch anonymisierte Bewerbungen dieser Diskriminierung auf dem Ausbildungsmarkt entgegengewirkt werden kann, sollen die Studierenden im Anschluss in einer "Talkshow" diskutieren. Dazu sollten sie zunächst Pro- und Contra-Argumente sammeln und anschließend (je nach Interesse) unterschiedliche Rollen einnehmen, z.B. Moderator/in, Jugendliche/r mit Migrationshintergrund, Jugendliche/r ohne Migrationshintergrund, Unternehmer/in, Experte/Expertin des Sachverständigenrats, Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration und Zuschauer/innen. Nach der Durchführung der Talkshow sollen die Studierenden schließlich zu einer eigenständigen, kriterienorientierten Beurteilung der Problemfrage gelangen, indem sie z.B. einen Brief an die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration verfassen.
Baustein 4: Der vierte Baustein beschäftigt sich mit der Problematik der Integration der seit 2015 neu zugewanderten Menschen in den Arbeitsmarkt. Wie diese gelingen kann, sollen die Studierenden vor dem Hintergrund ihrer erworbenen Erkenntnis über soziale Ungleichheit durch Migration und ethnische Herkunft selbst überlegen und entsprechende Maßnahmen in Kleingruppen entwickeln.
|
Thema / Problem |
Fachdidaktische |
Diagnostik/ |
Kompetenzen, zugleich Evaluationsindikatoren |
Materialien |
|
Sequenz 1: Was ist Rassismus? | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Was ist Rassismus? |
|
|
Übergeordnete Kompetenzen:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Konkretisierte Kompetenzerwartungen:
|
|
|
Alltäglicher Rassismus? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sequenz 2: AfD, Pegida & Co: Islam- und Fremdenfeindlichkeit in rechtspopulistischen Parteien und Gruppen | ||||
|
Was ist Rechts- populismus? |
|
|
Übergeordnete Kompetenzen:
|
|
|
AfD, Pegida und Co und ihre Gegner: |
|
|
|
|
|
Welche Rolle spielen Islam- und Fremdenfeindlichkeit in rechtspopulistischen Parteien und Organisationen? |
|
|
Konkretisierte Kompetenzerwartungen:
|
|
|
Was ist die AfD für eine Partei? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sequenz 3: Rechtspopulistische Parteien in Europa | ||||
|
Welches Gesicht hat der Rechtspopulismus in Europa? |
|
|
Übergeordnete Kompetenzen:
|
|
|
Rechtspopulismus: Eine Gefahr für ein vereinigtes Europa? |
|
|
Konkretisierte Kompetenzerwartungen:
|
|
|
Sequenz 4: Lügenpresse- Vorwurf und Fake-News: eine Gefahr für die Demokratie? | ||||
|
Lügenpresse: Ein Begriff macht Karriere |
|
|
Übergeordnete Kompetenzen:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Konkretisierte Kompetenzerwartungen:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fake-News: Gerüchte über Zuwanderer |
|
|
|
|
Zeitbedarf: insgesamt ca. 14 Std.

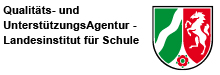
 Kontakt
Kontakt