1 Aufgaben und Ziele
Das Ziel des Deutschunterrichts in der Primarstufe ist es, Schülerinnen und Schüler zu einer grundlegenden rezeptiven und produktiven Text- und Gesprächskompetenz zu befähigen. Dies ist die Voraussetzung für ihren schulischen Erfolg – nicht nur in der Primarstufe, sondern auch in ihrer weiteren Schullaufbahn und für das lebenslange selbstständige Lernen.
Im Mittelpunkt des Deutschunterrichts steht dabei Sprache als Verständigungsmittel und als Möglichkeit der Welterschließung. Die verschiedenen Realisationsformen von Sprache – beim Sprechen und Zuhören, beim Lesen und Schreiben – sind für den Deutschunterricht zentral. An die Vorläuferfähigkeiten anknüpfend, die Kinder vor Schuleintritt erworben haben, fördert der Deutschunterricht die Basiskompetenzen und entwickelt sie weiter.
Damit Schülerinnen und Schüler im Deutschunterricht die Kulturtechniken des Lesens und Schreibens als persönlichen Gewinn erfahren, bedarf es insbesondere beim Lesen- und Schreibenlernen herausfordernder, bedeutsamer und lebensnaher Situationen. Der Deutschunterricht muss die Möglichkeit bieten, Freude an sprachlicher Gestaltung und sprachlichem Spiel zu erleben, sprachliches Selbstvertrauen weiterzuentwickeln und Bewusstheit im Gebrauch der deutschen Sprache auszubauen. Damit geht die Entwicklung einer Erzähl- und Gesprächskultur sowie einer Lese- und Schreibkultur einher, die Schülerinnen und Schülern eine gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe ermöglicht. Dies umfasst auch den Erwerb ästhetischer Erfahrungen im Umgang mit Sprache und Literatur.
Der Deutschunterricht muss so angelegt sein, dass er den Schülerinnen und Schülern ermöglicht, Lesefreude zu entwickeln. Sie sollen erfahren, dass eine intensivere Auseinandersetzung mit der Welt möglich ist, wenn sie über Lesefähigkeiten verfügen und mit unterschiedlichen Texten und Medien umgehen.
Die unterschiedlichen Spracherfahrungen in Deutsch und weiteren Herkuftsprachen sowie die vorhandenen sprachlichen Kompetenzen der Kinder sind die Ansatzpunkte für die weitere systematische Anbahnung bildungssprachlicher Kompetenzen im Sinne einer durchgängigen Sprachbildung, die die individuelle Förderung einschließt. Mit Hilfe von Diagnoseinstrumenten erheben die Lehrerinnen und Lehrer die Lernstände, beobachten die Lernentwicklung und evaluieren die Wirksamkeit der Unterrichtsarrangements und der Fördermaßnahmen.
Damit sich Kinder sprachlich weiterentwickeln können, muss ein anregendes und akzeptierendes soziales Miteinander in gegenseitiger Wertschätzung hergestellt werden, in dem das Lernen in der Gemeinschaft einen festen Platz hat. Das positive Vorbild der Lehrerinnen und Lehrer im sprachlichen und sozialen Handeln ist eine wesentliche Voraussetzung dafür.
Bedeutsam für einen integrativen und fächerübergreifend angelegten Deutschunterricht sind die Alltagserfahrungen der Kinder, bisherige und neue Sacherfahrungen, ein fantasievoller Umgang mit Sprache sowie kulturelle Traditionen und die Entwicklung einer kulturellen Praxis in der Schule und in der Klasse. Unter dem Aspekt interkultureller Erziehung werden dazu auch Sprachen und literarische Traditionen anderer Länder einbezogen.
Kinder, die Deutsch als Zweitsprache lernen, erfahren im Deutschunterricht besondere Unterstützung beim Lernen. Dabei werden ihre kulturellen Erfahrungen und sprachlichen Kompetenzen in den Herkunftssprachen als Bereicherung des Deutschunterrichts aufgegriffen und – ebenso wie der Vergleich mit der englischen Sprache – als Anlass zur vergleichenden Sprachbetrachtung genutzt.
Gemäß dem Bildungsauftrag der Primarstufe leistet das Fach Deutsch einen Beitrag dazu, den Schülerinnen und Schülern elementare Fähigkeiten, Kenntnisse, Fertigkeiten und Werthaltungen zu vermitteln und damit eine Grundlage für die weitere Schullaufbahn zu legen.
Es ist Aufgabe der Primarstufe, die Fähigkeiten, Interessen und Neigungen aller Schülerinnen und Schüler aufzugreifen und sie mit den Anforderungen fachlichen und fächerübergreifenden Lernens zu verbinden. Die in den Lehrplänen beschriebenen Kompetenzerwartungen stellen eine Bezugsnorm für das Gemeinsame Lernen dar, da die Kompetenzen in unterschiedlichem Umfang, in unterschiedlichem Anforderungsniveau und Komplexität erworben werden können.
Mit Eintritt in die Primarstufe verfügt jedes Kind über sehr individuelle Lern- und Bildungserfahrungen. In Ergänzung der frühkindlichen Bildung in der Familie gehört zu den Aufgaben des Elementarbereichs die ganzheitliche Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit durch informelle, erkundende und spielerische Lernformen. Im Sinne eines Kontinuums greift die Primarstufe individuelle Lern- und Bildungserfahrungen in der Schuleingangsphase auf, führt sie alters- und entwicklungsgemäß fort und leitet behutsam Formen systematischen Lernens und Arbeitens an.
Da in allen Fächern der Primarstufe fachliches und sprachliches Lernen eng miteinander verknüpft sind, ist es die gemeinsame Aufgabe und Verantwortung aller Fächer, die bildungssprachlichen Kompetenzen aller Schülerinnen und Schüler als wichtige Voraussetzung zum Lernen und für den Schulerfolg zu entwickeln und zu stärken. Mehrsprachigkeit wird dabei als Ressource für die sprachliche Bildung verstanden.
Im Rahmen des allgemeinen Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule unterstützt der Unterricht im Fach Deutsch die Entwicklung einer mündigen und sozial verantwortlichen, für ein friedliches und diskriminierungsfreies Zusammenleben einstehenden Persönlichkeit. Das Fach leistet weiterhin Beiträge zu fachübergreifenden Querschnittsaufgaben in Schule und Unterricht, hierzu zählen u. a.
- Menschenrechtsbildung,
- Werteerziehung,
- politische Bildung und Demokratieerziehung,
- Medienbildung und Bildung für die digitale Welt,
- Verbraucherbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung,
- geschlechtersensible Bildung,
- kulturelle und interkulturelle Bildung.
Die inhaltlichen Kooperationen mit anderen Fächern und Lernbereichen sowie außerschulisches Lernen und Kooperationen mit außerschulischen Partnern können sowohl zum Erreichen und zur Vertiefung der jeweils fachlichen Ziele als auch zur Erfüllung übergreifender Aufgaben beitragen.
Der vorliegende Lehrplan ist so gestaltet, dass er Freiräume für Vertiefung, schuleigene Projekte und die Beachtung aktueller Entwicklungen lässt. Die Umsetzung der verbindlichen curricularen Vorgaben in schuleigene Vorgaben liegt in der Gestaltungsfreiheit – und Gestaltungspflicht – der Fachkonferenzen sowie der pädagogischen Verantwortung der Lehrerinnen und Lehrer. Damit ist der Rahmen geschaffen, gezielt Kompetenzen und Interessen der Schülerinnen und Schüler aufzugreifen und zu fördern bzw. Ergänzungen der jeweiligen Schule in sinnvoller Erweiterung der Kompetenzen und Inhalte zu ermöglichen.

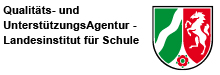
 Kontakt
Kontakt