1 Aufgaben und Ziele
Aufgabe des Kunstunterrichts in der Primarstufe ist die Entwicklung des individuellen Wahrnehmungs-, Vorstellungs- und Ausdrucksvermögens der Schülerinnen und Schüler. Der Kunstunterricht initiiert und ermöglicht ästhetische Erfahrungs- und Erkenntnisprozesse, in denen die Schülerinnen und Schüler sich wahrnehmend und deutend, praktisch gestaltend sowie reflektierend und urteilend mit sich selbst, mit anderen und mit ihrer – auch multimedial vermittelten – Lebenswelt auseinandersetzen können.
Damit leistet der Kunstunterricht innerhalb des Fächerkanons einen wichtigen Beitrag zur Förderung von Bildkompetenz sowie zur Persönlichkeits- und Identitätsentwicklung. Der Kunstunterricht vertieft Einsichten in die Gestaltbarkeit von Leben und Kultur, Umwelt und Gemeinschaft. Eigene Visionen von Welt können entwickelt sowie bildnerisch dargestellt werden und befähigen zur aktiven Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
Bilder sind für alle Schülerinnen und Schüler Teil ihrer Alltagswelt und werden bewusst oder unbewusst wahrgenommen sowie in ihre Konstruktion von Wirklichkeit integriert.
Der Begriff Bild umfasst – im Verständnis eines erweiterten Bildbegriffs – sowohl mentale Bilder wie Vorstellungen, Fantasien und Wünsche als auch Bilder aus dem soziokulturellen Raum (Kunst, Alltag und Medien). Diese stehen in wechselseitigem Bezug und werden durch individuelle, kulturelle und historische Bedingungen beeinflusst.
Bilder haben verschiedene Eigenschaften und Ausdrucksformen. Dabei kann zwischen den Bildmitteln der Gestaltung (Farbe, Form und Material) und den räumlichen, flächigen oder zeitlichen Dimensionen von Bildern unterschieden werden. Letztere betreffen Aspekte der Zwei- bzw. Dreidimensionalität (wie Bezüge auf der Fläche, Ausdehnung im Raum) oder zeitbezogene Eigenschaften (wie Geschwindigkeit, Rhythmus), bspw. in (audio-)visuellen Bewegtbildern, Inszenierung und Spiel. Die ästhetischen Eigenschaften und Ausdrucksformen von Bildern lassen sich oft in Mischformen wiederfinden. Bilder können sich als vielseitige Form-Inhalts-Gefüge zeigen und verschiedene inhaltliche Funktionen besitzen, wie z. B. Erzählung, Ausdruck, Erfindung, Dokumentation, Information, Manipulation oder Orientierung. Dem gesamten Lehrplan liegt dieses Verständnis eines erweiterten Bildbegriffs zu Grunde.
Über Bilder können neue und auch ungewöhnliche Arbeits-, Sicht- und Denkweisen in besonderer Weise gefördert und angestoßen werden. Erkenntnisprozesse wie Nachempfinden und Nachvollziehen, Einordnen und Vergleichen, Fragen und Vermuten, kritisch Hinterfragen und Sinn finden werden eröffnet und dadurch die Bildkompetenz gefördert. Bildkompetenz meint die Fähigkeit zur aktiven Produktion und Rezeption von Bildern im Sinne des erweiterten Bildbegriffs. Dabei entwickelt sich Bildkompetenz als kumulativer Prozess in enger Verzahnung von Rezeptions- und Produktionsprozessen, die in komplexer Weise aufeinander bezogen werden. Reflexion ist immanenter Bestandteil von rezeptiven und produktiven Prozessen. Rezeptive Prozesse sind das Wahrnehmen, Erleben, Beschreiben, Imaginieren, Analysieren und Interpretieren, in denen das eigene Empfinden, die Wirkung des Kunstwerks auf das Individuum und das Deuten im Vordergrund stehen. Produktive Prozesse beinhalten das Entwickeln von Bildideen, das freie und gezielte Experimentieren, das sachgerechte Anwenden von Materialien und Werkzeugen und das Gestalten mit bildnerischen Mitteln sowie Strategien in eigenen Bildzusammenhängen. Reflexive Prozesse fokussieren das Verstehen und Kommunizieren über eigene und fremde Bilder durch Vergleichen, Hinterfragen, Herstellen von Zusammenhängen, Bilden ästhetischer Urteile und kriteriengeleitetes Bewerten.
Bildkompetenz umfasst neben überprüfbaren, produktiven und rezeptiven Kompetenzen, die nachfolgend als Kompetenzerwartungen ausgewiesen werden, noch eine Vielzahl an Erfahrungen und Fähigkeiten, die in besonderem Maße individuell geprägt sind. Diese fließen in produktive, rezeptive und reflexive Prozesse ein. Dazu gehören u. a. Kreativität und Fantasie, Wahrnehmungsfähigkeit, Empfindsamkeit, Imaginationsfähigkeit und Genussfähigkeit. Diese entziehen sich einer standardisierten Überprüfung und sind dennoch als grundlegende Fähigkeiten zu fördern und zu entwickeln.
Die Ausbildung von Bildkompetenz als übergeordnete fachliche Kompetenz kann nicht nur selbstbestimmtes und schöpferisch-gestalterisches Handeln fördern, sondern auch einen differenzierten Umgang mit Bildern ermöglichen und somit Orientierung in einer bildgeprägten Welt bieten.
Die Erfahrungsfelder der Schülerinnen und Schüler sowie ihre entwicklungsbedingten Verhaltens- und Ausdrucksweisen (z. B.: Sammeln, Ordnen, Forschen, Spielen, Experimentieren, Malen, Zeichnen, Plastizieren, Spielen, Inszenieren) sind Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung persönlichkeitsbildender und fachlicher Kompetenzen im Kunstunterricht.
Kunstunterricht ist so anzulegen, dass die fachlichen und persönlichkeitsbildenden Kompetenzen im Zusammenhang mit altersgemäßen Inhalten, Themen und Intentionen sinnhaft erarbeitet werden. Diese generieren sich aus den Erfahrungsfeldern der Kinder, wie z. B. Ich, Mensch und Gesellschaft, Vorstellungswelten, Räume und Lebensumfeld, Natur, Mobilität und Umwelt, Technik und Arbeitswelt, Zeit und Kultur. Dies intendiert, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Sichtweisen ausloten und finden sowie ausdrücken und darstellen können. Dabei kommt außerschulischen Lernorten (z.B. Museen, Ateliers) eine besondere Bedeutung zu.
Die Ziele des Kunstunterrichtes bedürfen einer Aufgabenkultur, die individuelle Zugänge, Lösungswege und -ergebnisse zulässt, Spielräume eröffnet und gleichzeitig Orientierung bietet, Partizipation sowie Kooperation ermöglicht und prozessorientiert angelegt ist.
Gemäß dem Bildungsauftrag der Primarstufe leistet das Fach Kunst einen Beitrag dazu, den Schülerinnen und Schülern elementare Fähigkeiten, Kenntnisse, Fertigkeiten und Werthaltungen zu vermitteln und damit eine Grundlage für die weitere Schullaufbahn zu legen.
Es ist Aufgabe der Primarstufe, die Fähigkeiten, Interessen und Neigungen aller Schülerinnen und Schüler aufzugreifen und sie mit den Anforderungen fachlichen und fächerübergreifenden Lernens zu verbinden. Die in den Lehrplänen beschriebenen Kompetenzerwartungen stellen eine Bezugsnorm für das Gemeinsame Lernen dar, da die Kompetenzen in unterschiedlichem Umfang, in unterschiedlichem Anforderungsniveau und Komplexität erworben werden können.
Mit Eintritt in die Primarstufe verfügt jedes Kind über sehr individuelle Lern- und Bildungserfahrungen. In Ergänzung der frühkindlichen Bildung in der Familie gehört zu den Aufgaben des Elementarbereichs die ganzheitliche Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit durch informelle, erkundende und spielerische Lernformen. Im Sinne eines Kontinuums greift die Primarstufe individuelle Lern- und Bildungserfahrungen in der Schuleingangsphase auf, führt sie alters- und entwicklungsgemäß fort und leitet behutsam Formen systematischen Lernens und Arbeitens an.
Da in allen Fächern der Primarstufe fachliches und sprachliches Lernen eng miteinander verknüpft sind, ist es die gemeinsame Aufgabe und Verantwortung aller Fächer, die bildungssprachlichen Kompetenzen aller Schülerinnen und Schüler als wichtige Voraussetzung zum Lernen und für den Schulerfolg zu entwickeln und zu stärken. Mehrsprachigkeit wird dabei als Ressource für die sprachliche Bildung verstanden.
Im Rahmen des allgemeinen Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule unterstützt der Unterricht im Fach Kunst die Entwicklung einer mündigen und sozial verantwortlichen, für ein friedliches und diskriminierungsfreies Zusammenleben einstehenden Persönlichkeit. Das Fach leistet weiterhin Beiträge zu fachübergreifenden Querschnittsaufgaben in Schule und Unterricht, hierzu zählen u. a.
- Menschenrechtsbildung,
- Werteerziehung,
- politische Bildung und Demokratieerziehung,
- Medienbildung und Bildung für die digitale Welt,
- Verbraucherbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung,
- geschlechtersensible Bildung,
- kulturelle und interkulturelle Bildung.
Die inhaltlichen Kooperationen mit anderen Fächern und Lernbereichen sowie außerschulisches Lernen und Kooperationen mit außerschulischen Partnern können sowohl zum Erreichen und zur Vertiefung der jeweils fachlichen Ziele als auch zur Erfüllung übergreifender Aufgaben beitragen.
Der vorliegende Lehrplan ist so gestaltet, dass er Freiräume für Vertiefung, schuleigene Projekte und die Beachtung aktueller Entwicklungen lässt. Die Umsetzung der verbindlichen curricularen Vorgaben in schuleigene Vorgaben liegt in der Gestaltungsfreiheit – und Gestaltungspflicht – der Fachkonferenzen sowie der pädagogischen Verantwortung der Lehrerinnen und Lehrer. Damit ist der Rahmen geschaffen, gezielt Kompetenzen und Interessen der Schülerinnen und Schüler aufzugreifen und zu fördern bzw. Ergänzungen der jeweiligen Schule in sinnvoller Erweiterung der Kompetenzen und Inhalte zu ermöglichen.

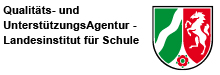
 Kontakt
Kontakt